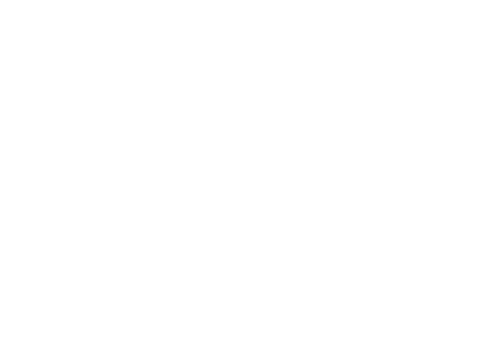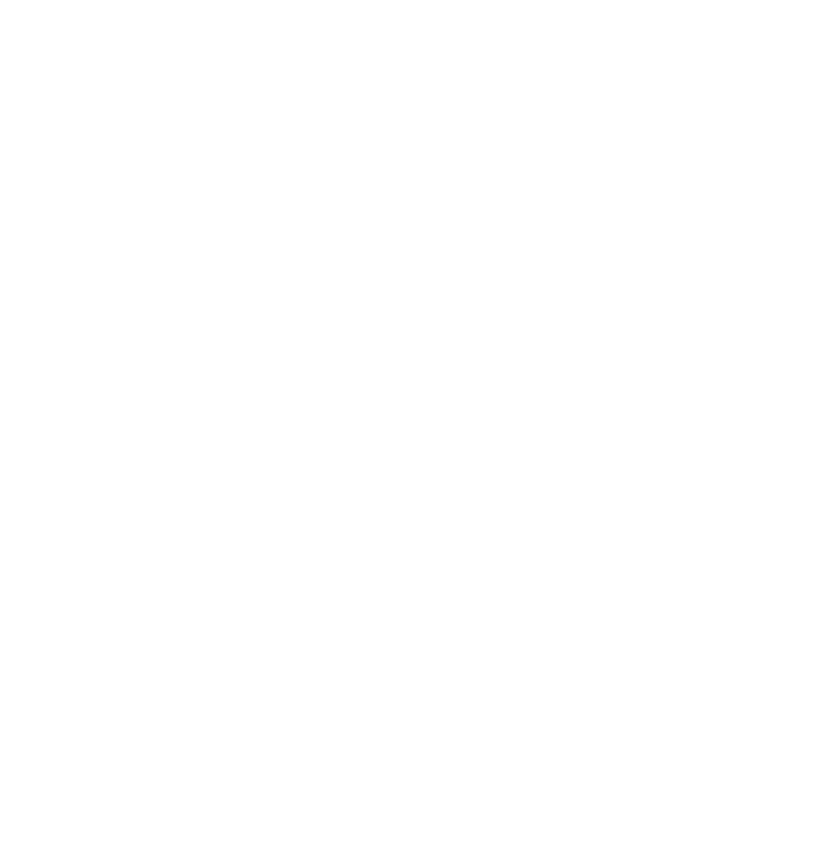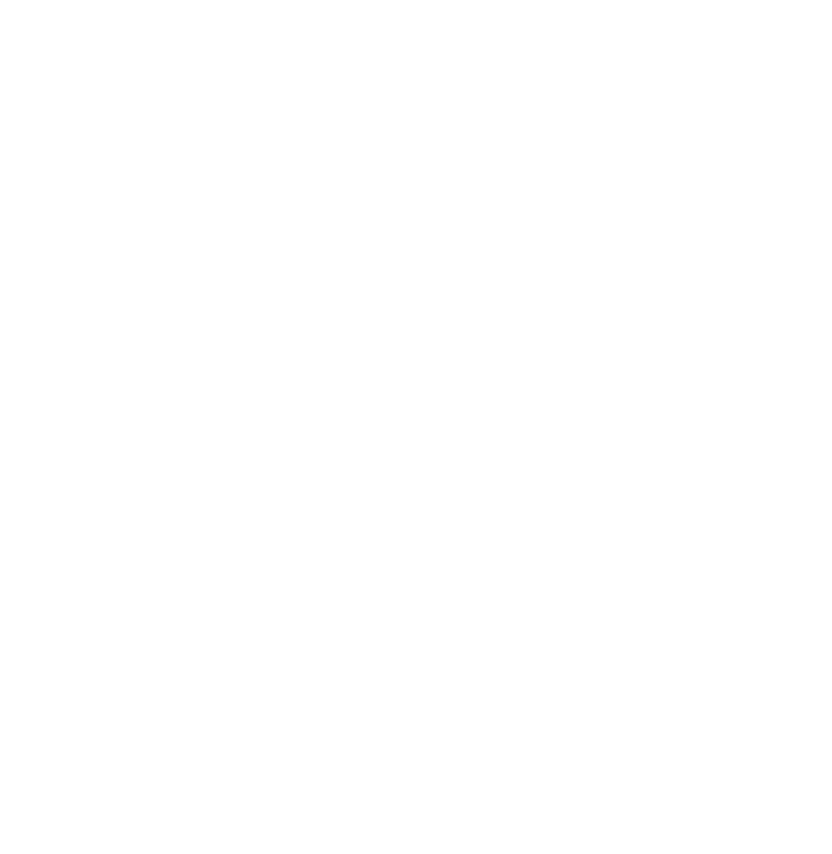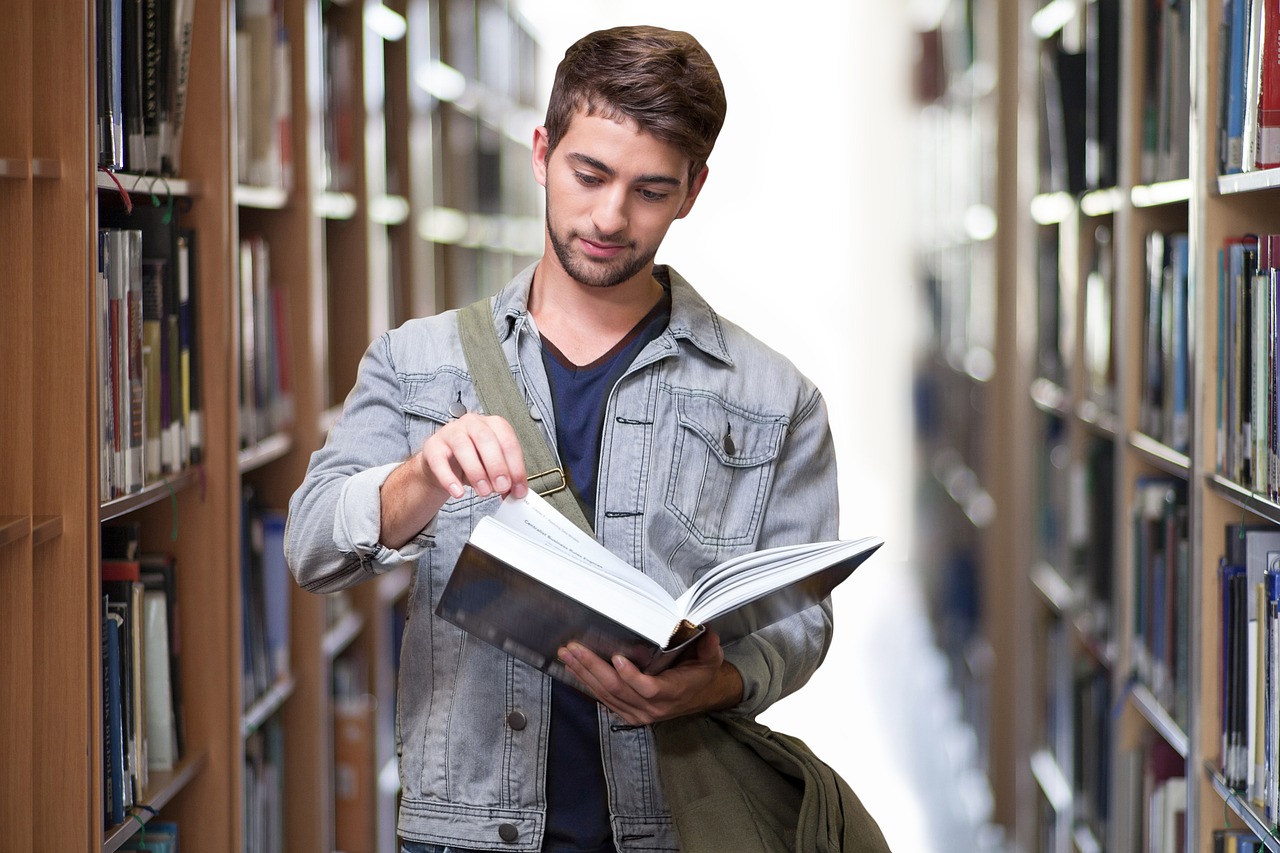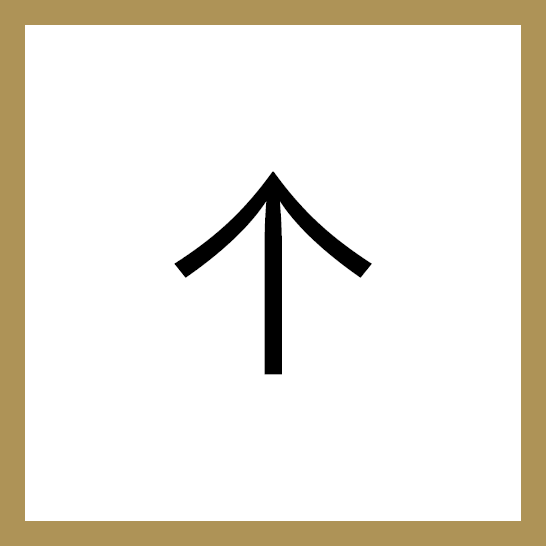Die Grundsätze und Grenzen einer gemeinsamen Haftung
1. Geschäfte die der Deckung des Lebensbedarfs dienen.
in § 1357 BGB ist geregelt, dass Geschäfte, die der angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie dienen von einem Ehegatten unter Mitverpflichtung des anderen Ehegatten abgeschlossen werden können.
Beispiele hierfür sind:
– der Einkauf von Nahrungsmitteln
– der Kauf von notwendiger Bekleidung
– der Kauf von Schulbüchern, Schulbedarf und Spielzeug für Kinder
auch Verträge mit regelmäßig wiederkehrenden Leistungen wie:
– Gas-und Stromlieferungsvertrag
– Telefonverträge
Maßgeblich für die Begründung der Mithaftung ist, dass bei vernünftiger Betrachtung davon auszugehen ist, dass der Ehepartner diesem Geschäft zustimmen würde. Hierbei ist der Lebenszuschnitt der jeweiligen Familieim Streitfall entscheidendes Kriterium.
Nicht einer gemeinschaftlichen Haftung unterzogen sind Ausgaben für persönliche Hobbys, Spielschulden, Darlehensverträge, der Kauf von Immobilien oder Grundstücken, etc.
2. Haftung für mietvertragliche Verpflichtungen nach Trennung.
Haben die Eheleute den Mietvertrag für die Ehe gemeinsame Wohnung gemeinsam unterzeichnet, so haften sie beide gegenüber dem Vermieter vollumfänglich auf die Zahlung der Miete.
Es ist ein häufiger Irrglaube, dass der Ehepartner, der nach der Trennung aus der ehegemeinsamen Wohnung auszieht, auch nicht mehr für die Miete haftbar zu machen ist. Der Vermieter ist auch nach seinem Auszug berechtigt, ihn auf die volle Miete in Anspruch zu nehmen. Der ausgezogene Ehegatte hat zwar gegenüber dem in der Wohnung verbleibenden Ehegatten nach einer gewissen Zeit im Innenverhältnis einen Anspruch auf Zahlung der Miete, doch wenn dieser nicht leistungsfähig ist kann der Vermieter die Mietschulden ihm gegenüber durchsetzen.
Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist haftet der ausgezogene Ehegatte in jedem Fall mit für die Miete.
Hat nur ein Ehegatte den Mietvertrag unterzeichnet, so haftet er allein gegenüber dem Vermieter.
3. Mithaftung für Schulden des Ehepartners nach Trennung.
Für Schulden, die der Ehepartner ab Trennung macht, haftet der andere Ehepartner grundsätzlich nicht. Dies gilt auch dann, wenn es sich um Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs handelt. Maßgeblich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Dieser muss nach der Trennung liegen. Ansonsten ist eine Haftung gegeben.
Ein häufiger Streitpunkt sind hier Stromlieferungsverträge. Diese wurden zumeist während des ehelichen Zusammenlebens abgeschlossen. Problematisch wird es, wenn nach Auszug des einen Ehegatten der in der Wohnung verbleibende Ehegatte die Stromrechnung nicht zahlt und der Stromlieferant sich an den ausgezogenen Ehegatten wendet. Dann bleibt der ausgezogene Ehegatte im Außenverhältnis gegenüber dem Stromanbieter mitverpflichtet. Dieser kann ihn auf den vollen Betrag in Anspruch nehmen.
Es ist daher ratsam, vor der Trennung geschlossene Dauerverträge gemeinsam zu kündigen, bzw. um eine einseitige Entlassung aus dem Vertrag zu bitten.
4. Keine gemeinschaftliche Haftung für Schulden, die nicht § 1357 BGB unterfallen.
Mit Ausnahme der unter § 1357 BGB fallenden Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs haftet der Ehepartner für Schulden des anderen Ehegatten nicht mit. Es gilt, dass nur derjenige aus einem Vertrag verpflichtet wird, der diesen auch unterzeichnet hat. Auch Spielschulden unterfallen nicht der gemeinsamen Haftung.
Auch wenn ein Ehepartner in die Privatinsolvenz geht, betrifft dies nur ihn und nicht den anderen Ehepartner. Dessen Vermögen ist hiervon nicht betroffen.